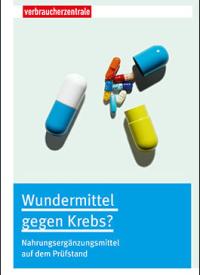Das Wichtigste in Kürze: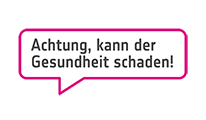
- Eine Belastung mit krebserregenden polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) ist vor allem von Nahrungsergänzungsmitteln mit Mikroalgen (getrocknete Spirulina und seltener Chlorella) sowie Propolis und Gelée Royale bekannt.
- Dioxine und PCB können bei Nahrungsergänzungsmitteln mit Tonerden (Mineralerden) ein Problem sein.
- Die Höchstgehalte sind im Detail in der neuen EU-Kontaminanten-Verordnung geregelt.
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in Nahrungsergänzungsmitteln
Immer wieder gibt es Meldungen von zu hohen, gesundheitsbedenklichen Mengen an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) wie Benzpyren (Benzo(a)pyren) in Nahrungsergänzungsmitteln. Betroffen sind neben (Kapseln mit) Pflanzenölen vor allem getrocknete Pflanzenprodukte wie Spirulina, Chlorella und Grüntee-Extrakt, aber auch Chia-Samen. Die hohen PAK-Gehalte in pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln lassen sich auf eine schlechte Herstellungspraxis und vor allem unsachgemäße Trocknung der Zutaten zurückführen.
Deswegen gibt es seit acht Jahren PAK-Höchstwerte für Nahrungsergänzungsmittel mit pflanzlichen Stoffen sowie für Nahrungsergänzungsmittel mit Kittharz, Gelée Royale und Spirulina (Benzo(a)pyren 10 µg/kg, Summenwert 50 µg/kg) . Außerdem wurden PAK-Höchstwerte für Pflanzenöle (2 µg/kg Benzo(a)pyren, 10 µg Summenwert)) festgelegt, die in Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt werden (VO (EU) 2023/915).
Im Europäischen Schnellwarnsystem gibt es immer wieder Meldungen zu Nahrungsergänzungsmitteln mit Matcha-, Ginkgo-, Grünem Kaffee- und Propolis-Pulver, aber auch Brahmi (Bacopa monnieri), vor allem bei Rohmaterialien aus China, auch zu Spirulina-Produkten aus Russland. Zuletzt wurden zu hohe Mengen in einem Extrakt aus Italien gemeldet.
Bei tierischen Nahrungsergänzungsmitteln, speziell Fischölkapseln, könnten polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) ein Problem sein. Ursache ist die Anreicherung in der Nahrungskette von der Alge bis hin zum Fisch. Hier wurde jedoch in den letzten Jahren regelmäßig kontrolliert, so dass in Omega-3-Produkten kaum noch PAK gefunden werden.
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) entstehen bei der unvollständigen Verbrennung von organischem Material wie Holz, Kohle oder Öl. Viele PAK haben krebserregende, erbgutverändernde und /oder fortpflanzungsgefährdende Eigenschaften. Diese Stoffe bleiben sehr lange in der Umwelt und werden kaum abgebaut. Weil sie fettlöslich sind, reichern sie sich im Fettgewebe von Mensch und Tier an. Die wichtigsten PAK in Lebensmitteln sind das besonders krebserregende Benzo(a)pyren, Benz(a)anthracen, Benzo(b)fluoranthen und Chrysen.
In Lebensmitteln findet man PAK vor allem bei Gegrilltem und in geräucherten Produkten. Auch geröstete oder getrocknete Lebensmittel wie Kakao/Schokolade, Kaffee, Tee, Freekeh (gerösteter grüner Weizen) oder Gewürze sind mit PAK belastet, wenn diese Verarbeitungsschritte in den Erzeugerländern unter nicht optimalen Bedingungen durchgeführt werden.
In wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern werden vor allem Holz, Kohle oder Stroh verfeuert, aber auch Abfälle. Werden diese Feuer verwendet, um Pflanzen wie Tees oder Kräuter zu trocknen, können über den Rauch PAK auf die Pflanzen und letztendlich auch in die Nahrungsergänzungsmittel gelangen.
Dioxine und polychlorierte Biphenyle (PCB) in Nahrungsergänzungsmitteln
Auch hoch giftige Dioxine und polychlorierte Biphenyle (PCB) können in Nahrungsergänzungsmitteln wie (grünen) Tonerden (Mineralerden) eine Rolle spielen. Dort gibt es sogenannte Auslösewerte (2013/711/EU und 2014/663/EU). Diese liegen unterhalb der Höchstgehalte und dienen als Frühwarnsystem, um Ursachen zu identifizieren, einzuschränken oder zu beseitigen, bevor es zu einer Überschreitung des Höchstgehaltes kommt. Hier sind die Anbieter in der Pflicht, die Werte regelmäßig zu kontrollieren.
Dioxine und PCB könnten auch in Ölen von Meerestieren (Fischölkapseln, Lebertran) enthalten sein. Vor allem fettreiche Fische wie Heringe und Lachse sind besonders in der östlichen Ostsee durch jahrelangen Eintrag über Abwässer zum Teil hoch mit Dioxinen belastet. Diese Schadstoffe können jedoch bei der Herstellung der Produkte durch technische Verfahren weitgehend entfernt werden. Seit mehr als 10 Jahren enthalten gängige Fischölkapseln gereinigte, standardisierte Konzentrate. Die aktuell geltenden Höchstwerte sind in der Verordnung (EU) 2023/915 festgelegt.
Dioxine sind hochgiftige Verbindungen. Der Begriff Dioxine bezieht sich auf zwei Klassen unterschiedlich chlorierter Verbindungen, nämlich 75 polychlorierten Dibenzo-p-dioxinen (PCDD) und 135 polychlorierten Dibenzofuranen (PCDF). Besonders bekannt geworden ist das 2,3,7,8- Tetrachlordibenzodioxin (TCDD), das in Anlehnung an eine Gift-Katastrophe in Norditalien auch „Seveso-Dioxin“ genannt wird. Zahlreiche Polychlorierte Biphenyle (PCB) ähneln in ihrem Molekülaufbau den Dioxinen. Sie werden deshalb dioxinähnliche PCB genannt.
Dioxine sind unerwünschte Nebenprodukte, die ebenfalls hauptsächlich bei Verbrennungsprozessen entstehen können. Viele Dioxine sind auch bei natürlichen Prozessen in der Erdgeschichte entstanden und haben sich in Ton und Erde angereichert.
Es gibt Dioxin-Höchstmengen für verschiedene Lebensmittel gemäß der EU-Kontaminantenverordnung.
Weitere Informationen dazu gibt es beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz sowie beim Bundesumweltamt.
Was kann ich selber tun?
- Sie sollten insbesondere bei Spirulina- und Chlorella-Produkten, Tonerden und Bienenprodukten kritisch sein und ggf. beim Hersteller nachfragen. Der Ursprung der Rohstoffe ist leider selten erkennbar. "Produziert in Deutschland" reicht als Herkunftsangabe nicht aus.
- Kaufen Sie eher Produkte gängiger Marken bzw. Handelsmarken oder im stationären Handel (wie Supermarkt, Drogeriemarkt, Reformhaus, Apotheke). Hier gehören Eigenkontrollen der Rohstoffe und natürlich der Endprodukte zum Alltag. Das gilt vor allem für Bio-Produkte.
- Besondere Vorsicht sollten Sie bei Produkten aus dem Nicht-EU-Ausland walten lassen.
Quellen:
Umweltbundesamt: Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe: Umweltschädlich! Giftig! Unvermeidbar? Aktualisierte Fassung, Januar 2016
Umweltbundesamt: Dioxine, Stand: 16.08.2021, zuletzt abgerufen am 22.09.2025
LGL Bayern: Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in Lebensmitteln. Stand: 17.04.2019, zuletzt abgerufen am 22.09.2025
E. Klein: Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in Lebensmitteln - Bilanz 2012. CVUA Sigmaringen, Stand: 28.05.2013, zuletzt abgerufen am 22.09.2025
LAVES: Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), kanzerogene Kontaminanten in Lebensmitteln, zuletzt abgerufen am 22.09.2025
LGL Bayern: Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in Nahrungsergänzungsmitteln (Fischölkapseln) - Untersuchungsergebnisse 2009, Stand: 18.04.2012, zuletzt abgerufen am 22.09.2025
Schill S; Müller M (CVUA Freiburg): Dioxine und polychlorierte Biphenyle (PCB) in Lebensmitteln und Futtermitteln – Untersuchungsergebnisse 2020. Stand: 29.06.2021, zuletzt abgerufen am 22.09.2025
Zelinkova Z, Wenzl T (2015): EU marker polycyclic aromatic hydrocarbons in food supplements: analytical approach and occurrence. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess. 32(11): 1914-26
Verordnung (EU) 2023/915 der Kommission vom 25.04.2023 über Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln, Fassung vom 22.07.2024
Auswertung des Schnellwarnsystems RASFF, zuletzt abgerufen am 22.09.2025