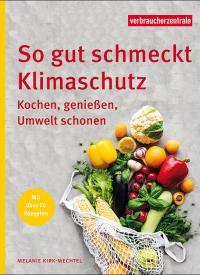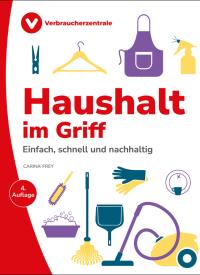Gründe für Verunreinigungen von Kunststoffen
Für das Recycling gesammelte Kunststoffe können aus unterschiedlichen Gründen chemisch verunreinigt sein. In der gelben Tonne und im gelben Sack werden leere Verpackungen aus Kunststoff, Metallen oder Verbundmaterialien gesammelt. Neben Lebensmittelverpackungen sind das beispielsweise auch leere Behälter von Putzmitteln oder Kosmetika.
Viele Verbraucher:innen sehen leere Lebensmittelverpackungen und Flaschen auch als praktische vorübergehende Aufbewahrungsmöglichkeit für sonstige Produkte, die keine Lebensmittel sind, an. Oft steckt dahinter gut gemeinter Wille, dem Abfall einen weiteren Zweck zu geben. So gelangen allerdings an der Verpackung haftende Rückstände von Farben, Kraftstoffen, Kühlmitteln und Rohrreinigern im Recycling-Kreislauf.
Auch ein hoher Anteil nicht recycelbarer Abfälle in der Sammlung kann zur Kontaminierung mit Stoffen führen, die nicht für den Lebensmittelkontakt geeignet sind. Und schon während der ersten Herstellung des Kunststoffs sind NIAS, also ohne Absicht eingebrachte Stoffe, nicht auszuschließen. Deren Menge und Identität sind bei gesammelten Kunststoffen unbekannt, möglicherweise zersetzt und dadurch verändert.
Vom entsorgten zum sicheren Kunststoff
Damit recycelter Kunststoff wieder für den Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden darf, muss er von allen gesundheitsschädlichen Verunreinigungen befreit werden – vor allem von chemischen Rückständen, da diese trotz der hohen Temperaturen im Recyclingprozess bestehen bleiben können. Die sogenannte Dekontaminierung, also die Entfernung dieser Schadstoffe, ist der zentrale und streng regulierte Schritt im Recycling-Verfahren.
Weil es unmöglich ist, jede potenzielle Verunreinigung zu erkennen und zu messen, legt die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) allgemeine Grenzwerte fest: Solange diese nicht überschritten werden, gilt der recycelte Kunststoff als gesundheitlich unbedenklich. Entscheidend ist also, dass die Recyclingtechnologie zuverlässig genug Schadstoffe entfernt, um diesen Sicherheitsstandard zu erfüllen.
Diese Recycling-Technologien sind geeignet
Aktuell sind zwei Recyclingmethoden für Kunststoffe zugelassen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen dürfen: das PET-Recycling aus Verbraucherabfällen und das Recycling aus geschlossenen, kontrollierten Kreisläufen wie in Kantinen oder Produktionsstätten. Beide Verfahren reinigen das Material gründlich und stellen durch Hitze und Dekontaminierung sicher, dass der recycelte Kunststoff genauso sicher ist wie neuer.
Um das Recycling von Kunststoffen zu fördern, ermöglicht die EU unter strengen Auflagen, dass neuartige Recycling-Technologien bereits vor ihrer offiziellen Zulassung genutzt werden dürfen – begleitet von transparenter Berichterstattung und regelmäßiger Prüfung. Ziel ist es, nur solche Technologien dauerhaft zuzulassen, die recycelte Kunststoffe in einer Qualität liefern, die genauso sicher ist wie neuer Kunststoff.