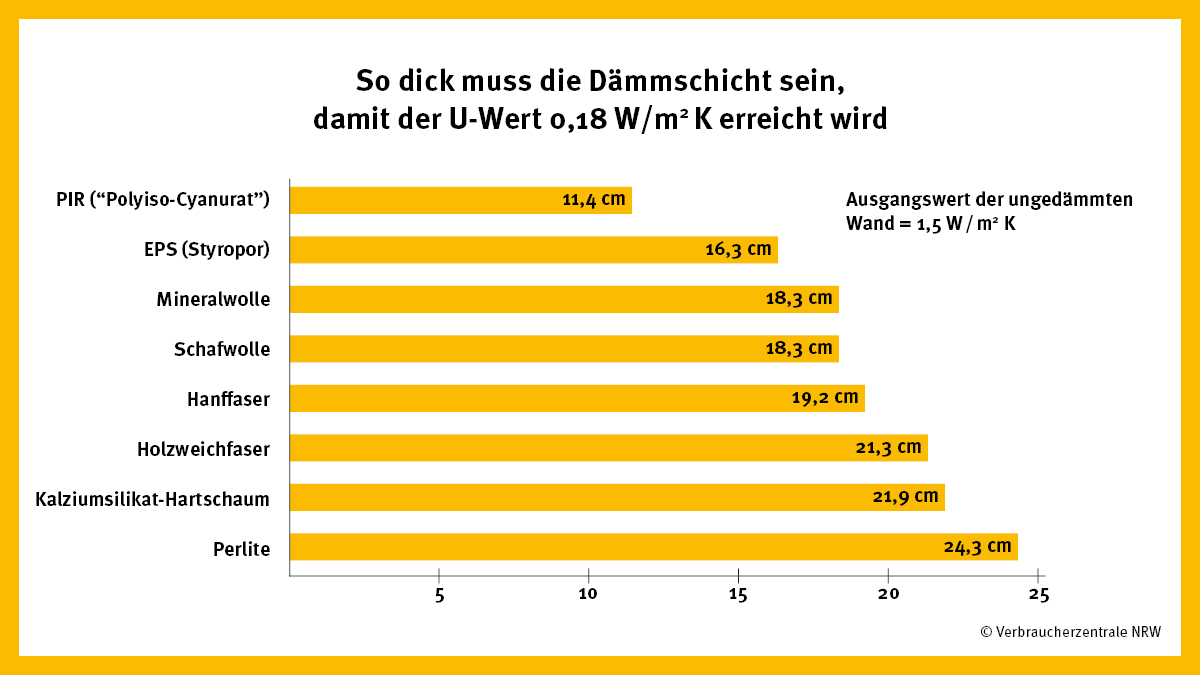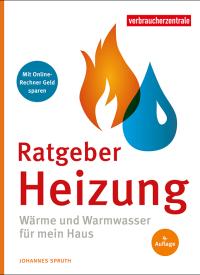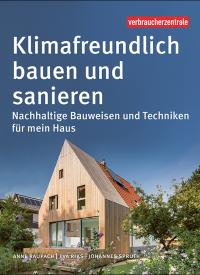Beim Dämmen auf Wärmebrücken und Luftdichtheit achten
Luftdichtheit ist unverzichtbar bei jeder Dämmschicht, sonst wirkt sie nicht richtig. Wird eine Wand oder Betondecke gedämmt, sind diese Flächen meist von sich aus luftdicht. Problematisch sind aber oft die Übergänge – etwa zwischen Fenster und Wand – oder Stellen, an denen Rohre, Kabel oder ein Kamin durch die Wand oder das Dach führen. Dort können trotz neuer Dämmung undichte Stellen entstehen.
Deshalb gilt: Eine luftdichte Gebäudehülle ist für die Energieeffizienz immer wichtig – auch ohne Dämmung. Dieser Aspekt wird allerdings oft vernachlässigt. In manchen Fällen geht durch Ritzen und Fugen mehr Heizwärme verloren als durch die gedämmten Flächen von Wänden und Dach zusammen. Deshalb lohnt es sich, im Zuge von Dämmmaßnahmen gezielt nach solchen Schwachstellen zu suchen und sie zu beseitigen. Eine Luftdichtheitsprüfung, zum Beispiel ein Blower-Door-Test, kann während einer Sanierung sinnvoll sein, um Leckagen aufzuspüren und zu beheben.
Bei einer Sanierung lohnt es sich oft, das Gebäude auf Luftdichtheit zu testen – so lassen sich undichte Stellen erkennen und gezielt abdichten. Wärmebrücken, also kleine Bereiche, durch die mehr Wärme strömt als durch normale Flächen, lassen sich nicht völlig vermeiden. Manche entstehen konstruktionsbedingt, etwa an Hausecken oder bei Stahlbetondecken.
Beim Dämmen kommt es darauf an, Wärmebrücken so gut wie möglich zu minimieren. Das betrifft bestehende, aber auch neue Wärmebrücken, die schnell übersehen werden können. Die wichtigste Regel ist dabei, dass eine lückenlose Dämmebene erstellt werden muss. Fenster gelten da übrigens als Teil der Dämmebene, die Dämmschicht sollte also direkt an die Fenster stoßen. Sollten Stellen auftauchen, an denen eine Lücke in der Dämmebene unvermeidlich ist, beispielsweise an Durchdringungen, so sind besondere Maßnahmen zu ergreifen, um den Wärmebrücken-Effekt minimal zu halten.
Macht Fassadendämmung Häuser hässlich?
Fassadendämmungen gelten mitunter als optisch wenig attraktiv. Sie lassen sich optisch aber auch ansprechend gestalten - das ist allerdings mit etwas höheren Kosten verbunden. Das gilt sowohl für Vorhangfassaden, als auch für Wärmedämmverbundsysteme. Putzornamente oder die Fenster optisch zu betonen, sind weitere Möglichkeiten.
Algenbildung ist auch ein häufiger Kritikpunkt. Es stimmt, dass Algen an einer gedämmten Wand im Zweifelsfall besser gedeihen als an einer ohne Dämmung. Dies betrifft aber nur Flächen, die ohnehin ungünstige Voraussetzungen haben, wie beispielsweise kaum Sonne im Tagesverlauf oder starke Witterungseinflüsse. Die Dämmung ist meistens nicht der entscheidende Punkt. Eine Dämmung gegündstigt den Algenwuchs auf sowieso kritischen Fassaden durch mehr Feuchtigkeit, aber entscheidend ist dieser Unterschied nicht.
Algen sind ein rein optisches Problem. Sie können auch wieder entfernt werden. Wer sie trotzdem vermeiden möchte, versucht die Fassade möglichst trocken zu halten, mit einem hinreichend großen Dachüberstand und Tropfkanten zum Beispiel. Auch ein recht dicker, dunkelfarbiger Putz kann hilfreich sein, der im Zweifel ein bisschen wärmer bleibt und weniger Feuchte anzieht.
Wie steht es mit dem Brandschutz bei der Fassadendämmung?
Eine fachgerechte Fassadendämmung erhöht das Brandrisiko in der Regel nicht. Zwar sind viele Materialien, aus denen Wärmedämmung besteht, grundsätzlich brennbar. Das gilt für Naturfasern ebenso wie für das verbreitete EPS. Beide Stoffe aus nachwachsenden Pflanzen oder fossilem Erdöl werden mit chemischen Flammschutzmitteln versetzt und damit zum schwer entflammbaren Dämmstoff. Absolut unbrennbar sind mineralische Dämmstoffe.
Doch brennbare Materialien sind im Bau keine Seltenheit: Dachstühle etwa sind meist aus Holz, ebenso wie Türen, Möbel und Treppen. Diese Elemente sind für die Ausbreitung eines Brandes in einem Ein- oder Zweifamilienhaus viel entscheidender als die Außenfassade - zumal die meisten Brände in diesen Gebäuden innen entstehen.