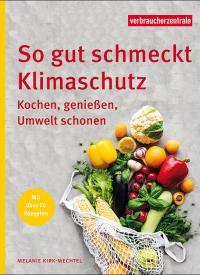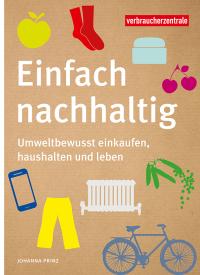Klimagesunde Ernährung bedeutet: Weniger tierische Lebensmittel, mehr Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte, weniger Lebensmittel wegwerfen und Vorrang für Produkte, die in der Region Saison haben.
Foto:
Verbraucherzentrale
Das Wichtigste in Kürze:
- Fleisch, Wurst und fettreiche Milchprodukte haben eine schlechte Klimabilanz. Wer tierische Produkte nur in Maßen genießt, tut deshalb etwas Gutes fürs Klima.
- Kurze Transportwege schonen die Umwelt. Bevorzugen Sie frische, reif geerntete Früchte aus der Region. Diese sind nicht nur klimafreundlicher, sondern schmecken intensiver und enthalten mehr Nährstoffe.
- Lebensmittel aus dem beheizten Gewächshaus sind besonders schlecht fürs Klima. Es lohnt sich daher, zu saisonalem Obst und Gemüse aus Freilandanbau zu greifen.
- Lebensmittelabfälle verschwenden wertvolle Ressourcen und belasten die Umwelt.
On
Klimaschutz macht auch vor dem Thema Ernährung nicht halt. Die Produktion von Lebensmitteln hat einen direkten Einfluss auf Umwelt und Klima. Wie der ökologische Fußabdruck im Einzelnen ausfällt, hängt davon ab, wie viel Wasser, Fläche und andere Ressourcen für Herstellung, Verarbeitung und Transport benötigt werden. Eine umfassende Umweltbewertung von Lebensmitteln ist daher gar nicht so leicht. Mit den folgenden Tipps kann eine klimafreundlichere Ernährung trotzdem gelingen.
Regionales Obst und Gemüse à la Saison
Ob Äpfel, Birnen oder Rhabarber, Feldsalat, Grünkohl oder Spargel – eine reichhaltige Palette an heimischem Obst und Gemüse sorgt für tägliche Abwechslung auf dem Speiseplan. Direktvermarkter und Landwirte bieten passend zur Jahreszeit häufig Waren aus eigenem Anbau an. Frische Früchte von Baum, Strauch und Feld, die keine weiten Transportwege hinter sich haben und reif geerntet werden, schmecken besser und enthalten mehr gesunde Inhaltsstoffe.
Besonders klimaschädlich ist der Transport von Obst und Gemüse mit dem Flugzeug, doch auch der Hochsee-Schifftransport oder LKW-Transporte verursachen CO2 und andere Schadstoffe. Einen Umweltvorteil haben regionale Produkte jedoch nur, wenn sie Saison haben und im Freiland, unter Folie oder in unbeheizten Gewächshäusern erzeugt werden.
Erdbeeren oder Tomaten, die im Winter in beheizten Gewächshäusern angebaut werden, sind besonders klimaschädlich, selbst wenn sie aus der Region stammen. Obstkonserven und Tiefkühlgemüse verursachen ebenfalls mehr Treibhausgase als die saisonalen, unverarbeiteten Varianten aus der Region. Deshalb gilt es, neben der Regionalität immer auch auf Saisonalität zu achten. Welche Sorten bei uns gerade Saison haben, verrät Ihnen der Saisonkalender für heimisches Obst und Gemüse.
Weniger tierische Produkte
Tierische Produkte haben im Vergleich zu pflanzlichen Lebensmitteln eine deutlich schlechtere Klimabilanz. Zum Vergleich: Die Produktion eines Kilos Rindfleisch verursacht durchschnittlich rund 14 Kilogramm Kohlendioxid. Bei der Erzeugung eines Kilos Gemüse, beispielsweise Bohnen, werden dagegen durchschnittlich nur etwa 0,8 Kilogramm des Treibhausgases freigesetzt.
Auch fettreiche Milchprodukte wie Butter oder Käse weisen eine eher ungünstige Klimabilanz auf, ähnlich der von Geflügel- oder Schweinefleisch. Wer nicht täglich Fleisch oder Wurst isst und fettreiche Milchprodukte in Maßen genießt, tut deshalb etwas Gutes fürs Klima.
Wenn Sie noch Anregungen für fleischfreie Mahlzeiten brauchen, finden Sie viele saisonale, gesunde und leckere Rezepte in unserem Ratgeber "Vegetarisch kochen".
Bio-Lebensmittel sparen Energie und sind weniger belastet
Im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft verbrauchen Bio-Bauern bei der Produktion nur etwa ein Drittel an fossiler Energie, da sie auf chemisch-synthetische Dünger und Pflanzenschutzmittel verzichten, die mit einem hohen Verbrauch an Energie erzeugt werden. Gleichzeitig benötigen sie im Vergleich zu herkömmlichen Betrieben aber mehr Fläche für den gleichen Ertrag.
Aus diesem Grund schneiden Bio-Lebensmittel in ihrer Klimabilanz nicht immer besser ab als konventionelle Produkte. Trotzdem bietet der Ökolandbau eine ganze Reihe an Vorteilen: weniger Pestizide und Rückstände, eine höhere Artenvielfalt und eine nachhaltigere Bodenbewirtschaftung, vor allem Humusaufbau, der CO2 binden kann. Berücksichtigt man all diese Faktoren, sind Bio-Lebensmittel im Vergleich zu konventionellen Produkten in ihrer Gesamtbilanz deutlich positiver zu bewerten.
Genießen statt verschwenden
Die Verschwendung von Lebensmitteln ist weltweit ein großes Problem. In Deutschland entsteht ein großer Teil der Lebensmittelabfälle in privaten Haushalten. Ungefähr 78 Kilogramm an Lebensmitteln werden pro Jahr und pro Kopf weggeworfen. Lebensmittelverluste verschärfen nicht nur den Welthunger, sondern belasten zugleich die Umwelt.
Landet Essen im Müll, werden dabei immer auch wertvolle Ressourcen wie Ackerboden, Wasser oder Energie verschwendet. Der WWF Deutschland schätzt, dass durch vermeidbare Lebensmittelverluste rund 15 Prozent der gesamten für unsere Ernährung in Deutschland benötigten Fläche eingespart werden könnten. Das entspricht in etwa der Fläche des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern.
Mit einem bewussten und wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln, einer bedarfsgerechten Einkaufsplanung und der richtigen Lagerung, lässt sich Lebensmittelverschwendung reduzieren und gleichzeitig das Klima schützen.
Podcast zum Greenwashing bei Lebensmitteln
Das könnte Sie auch interessieren